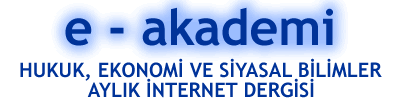|
|||||||||
|
Makale:
Ansichten über die Änderungen im Familienrecht im neuen Zivilgesetzbuch
Yrd.Doç.Dr. Veysel Baþpýnar*
ÖZET
“YENÝ MEDENÝ KANUN’DA AÝLE HUKUKU BAKIMINDAN YAPILAN DEÐÝÞÝKLER HAKKINDA GÖRÜÞLER”
1.1.2002 tarihinde yürürlüðe giren Türk Medeni Kanunu, Medeni Hukukun bir çok alanýnda deðiþiklikler ve yenilikler getirmiþtir. Bu çalýþmada söz konusu deðiþiklik ve yeniliklerden yalnýzca aile hukukunda yapýlan deðiþiklikler üzerine görüþ ve düþünceler dile getirilmiþtir.
Yeni Medeni Kanun ile boþanma sebepleri, aile mal rejimleri, evlatlýk iliþkisinin
kurulmasý, bazý hukuki iþlemlerin ancak her iki eþin rýzasýyla yapýlabilmesi
ve dolayýsýyla eþlerden birinin diðerine karþý korunmasý konularýnda önemli
yenilikler getirilmiþtir. Kanaatimizce bu deðiþikliklerden çoðu olumludur.
Bununla birlikte Kanunda ilave bir takým deðiþikliklerin de yapýlmasýnda yarar
görülmektedir.
1.Geschichte /Historie
Parg. 1. Die Reformvorhaben über das türkische Zivilgesetzesbuch vom 1971[1] und 1984[2] konnten nicht umgesetzt werden. Im Jahr 1996 wurde eine neue Kommission durch das Justizministerium gegründet, mit der Aufgabe, Gesetzesentwürfe für das Zivilgesetzbuch (ZGB) vorzubereiten. Die von der Kommision vorbereitete ZGB-Entwürfe wurden im Jahre 1998 vom Justizministerium veröffentlicht. Jedoch wurde die in den Entwürfen enthaltene gesetzliche Gütertrennungsprinzip von der Kommission zu „Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung“ („edinilmis mallara katilma rejimi“) geändert. Somit entstand der ZGB-Entwurf vom 1999. Dies bildete die Grundlage für das am 01.01.02 in Kraft getretene neue Türkischen ZGB[3].
Parg. 2. Dieses neue ZGB (gültig ab 01. Januar 2002) bringt viele Änderungen im Vergleich zum alten ZGB (aZGB). Die wichtigsten Neuigkeiten sind die Änderungen in den Artikelnummern, alle Artikelnummern wurden geändert. Auch inhaltsmässig wurden sehr viele Änderungen vorgenommen. Jedoch wurde, sei es in den Medien sei es bei der Bevölkerung, der Eindruck erweckt, als beträfen die wichtigsten Änderungen im neuen Gesetz den Güterstand zwischen den Ehegatten. Es gibt sogar eine Meinung in der Literatur, die dieses Gesetz zu einer Revolution kürt[4]. Kurz gesagt, ist die allgemeine Überzeugung in der Bevölkerung, dass die Reform nur die Vermögensverwaltungänderungen betreffe.
Parg. 3. Wenn man aber die Änderungen etwas genauer untersucht, erkennt man, dass die Änderungen nicht einfach sind. In der Tat bestehen die Änderungen nicht bloß aus den Regelungen bezüglich des Vermögens (Güterstandes) und der Vermögensverwaltung. Im neuen Gesetz sind , beginnend mit den allgemeinen Regelungen bis hin zu den Straftatbestandsregelungen bezüglich Grundbuchsangelegenheiten, in sehr vielen Gebieten äußert wichtige Änderungen vorgenommen worden.
Parg. 4. Eine umfassende Untersuchung dieser sehr wichtigen Änderungen übersteigt den Rahmen dieser Abhandlung. Aus diesem Grund wurden die Änderungen zusammenfassend im Folgenden erläutert;
Parg. 5. Im Gesetz wurde, entsprechend dem Grundsatz der Gleichberechtigung, auf die Regel bezüglich des Wohnsitzes der Frau, die vom Mann abhängig war, verzichtet[5]. (Art. 21/1).
Parg. 6. Im speziellen gilt bezüglich des Wohnsitz des unter dem Sorgerecht stehenden Kindes (Art. 21/1) die Regelung: „wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnort haben, dann gilt der Wohnort des Elternpaares als Wohnort des Kindes, bei dem das Kind lebt“. Diese Regelung entspricht auch den Bestimmungen der von der UNO am 18. Dezember 1979 verabschiedeten „Internationalen Vereinbarung zur Verhinderung von jeglicher Art von Diskriminierung gegen Frauen“ akzeptiert wurden[6].
Parg. 7. In der Tat, steht in der genannten Vereinbarung, dass die „Mitgliedsländer Frauen und Männern die gleichen Rechte bezüglich Wohnortswahl und Wohnortwechsel zu gewähren“ haben.
2. Die Änderungen im Familienrecht
A. Verlobung
Parg. 8. Im Entwurf von 1998 wurde die Verlobung als Vorvereinbarung[7] angesehen, jedoch diese Ansicht wurde im Gesetz aufgegeben(Art. 117/II). ZGB Art. 120 regelt die Beendigung der Verlobung; in diesem Artikel wurden die Tatbestände zu Klageeinbringung erweitert. Tatsächlich werden die Klagen nicht nur in Falle von Auflösung der Verlobung, in Anspruch genommen, sondern in anderen Fällen wie z.B. in Todesfallen oder anderen Gründen. Denn im Gesetz ist der Ausdruck „die aufgrund der Verlobungsbeendigung entstehenden Klagerechte“ zu finden. Hinsichtlich der Klageerhebung hat dýe Trennung zwischen Mann und Frau keinen Relevanz mehr; d.h. beide haben dieselben Rechte[8].
B. Ehe
Parg. 9. Im neuen ZGB wurde das Mindestheiratsalter ohne Geschlechterunterscheidung auf 17 festgelegt. Das bedeutet, dass man das 17. Lebensjahr vollenden muss, um heiraten zu können. Im Ausnahmefällen darf jedoch mit 16 geheiratet werden (Art. 124). Auf der anderen Seite wurde das außergewöhnliche Heiratsalter auf 16 festgestellt, ohne eine Geschlechtertrennung zu machen. (Art. 124)
Parg. 10. Das absolute Heiratsverbot für Geisteskranke wurde aufgehoben (aZGB Art. 89/II). Im neuen ZGB ist der Ausdruck „solange es von einer amtlichen Gesundheitsbehörde keinen Nachweis vorliegt, der keine medizinische Bedenken bezüglich eines Heirats von Geisteskranken feststellt, dürfen die Geisteskranken nicht heiraten“[9]. Außerdem wird in der neuen Regelung, wenn der gesetzliche Vertreter seine Befugnisse in bezug auf Erlaubniserteilung in Heiratssachen überschreitet bzw. missbräuchlich anwendet, räumt die neue Regelung das Recht ein, einen Richter mittels eines Antrags beim Gericht in solchen Angelegenheiten heranzuziehen (Art. 128)[10].
C. Scheidung und Trennung
Parg. 11. Die Scheidungsgründe im Schweizerischen Recht wurden geändert. Durch diese Änderung verabschiedete man sich von der Tradition, die die Scheidungsgründe in 2 Gruppen (1. Spezielle Gründe, 2. Allgemeine Gründe) einteilte[11]. Trotz dieser Änderung in Schweiz, existiert diese Tradition, die eine Trennung bei den Scheidungsgründen vorsieht, in der Türkei noch weiter. Außerdem wurde Art. 162 um „Ehrenkränkung“ (Verhalten, die zur Ehrenverletzung führt) als ein dritter Scheidungsgrund hinzugefügt[12].
Parg. 12. Auf der anderen Seite sieht die im Art. 163 enthaltene Regelung vor, dass die Straftat nur dann als Scheidungsgrund anzunehmen ist, wenn die Tat für den anderen Ehegatten unerträglich ist. Mit anderen Worten, es reicht nicht aus, dass der Ehegatte eine Straftat begonnen hat, sondern es ist noch die Unerträglichkeitsbedingung erforderlich.
Parg. 13. Bei der Scheidung aufgrund von Verlassen wurde die Frist von drei Monaten auf sechs Monaten verlängert (Art. 164 /I). Zweck dieser Fristerhöhung ist eine Verlängerung der Zeit für die Hoffnung auf Versöhnung der Ehegatten und um eine längere Zeit für das Überlegen. Mit dieser Frist wird, insbesondere wenn ein Ehepartner aus unüberlegten Gründen die gemeinsame Wohnung verlässt, beabsichtigt, dass der Ehepartner sein fehlerhaftes Verhalten im Laufe der Zeit einsieht, und keinen unwiderruflichen Fehler begeht[13].
Parg. 14. Weiters wurde die einmonatige Warnungsfrist um einen weiteren Monat erhöht. Nach der neuen Regelung kann die Warnung, wenn erforderlich, auch mittels öffentlicher Anzeige gemacht werden (Art. 164/II)[14]. Mit dem neuen Gesetz wird dem Richter auch das Recht eingeräumt, im Laufe einer Scheidung spezielle Vorkehrungen zu treffen. Danach trifft der Richter Entscheidungen bezüglich der Wohnungs- und Einrichtungsgegenständen darüber, wer diese benutzen kann. Der Richter wird die erforderlichen Vorkehrungen treffen, wenn die Ehegatten beschlossen haben, getrennt zu leben. (Art. 197/II)
Parg. 15. Im Laufe eines Scheidungsverfahrens hat wieder der Richter das Recht, der Verfügungsbefugnis der Ehepaaren in finanziellen Angelegenheiten Grenzen zu setzen. Mit derselben Art kann der Richter erforderliche Maßnahmen treffen Wenn der Richter die Verfügungsbefugnis einer Ehegatte bezüglich einer unbeweglichen Sache aufhebt, hat er vom Amts wegen zu entscheiden, dies in das Grundbuch einzutragen (Art. 199/III) Diese Vorschriften bezweckt im speziellen eine Verhinderung. Und zwar man will verhindern, dass der Ehemann das Vermögen irgendwie seiner Frau „wegnimmt“. In der Tat ist der spezielle Grund dieser Regelung, dem zur Scheidung entschlossenen Ehemann daran zu hindern, das Vermögen an andere zu übertragen, mit der Absicht der Ehefrau keine Unterhaltszahlungen zu leisten. Somit wird die Ehefrau mittelbar geschützt[15].
Parg. 16. Nach der neuen Regelung ist das zuständige Gericht für das Scheidungsverfahren, das sich am Wohnort eines der Ehepartner befindet, oder das Gericht des Ortes, wo sich die Ehepartner seit den letzten 6 Monaten vor dem Scheidungsverfahren wohnen zuständig(Art. 168). Diese Regelung entspricht dem Grundsatz der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau.
Parg. 17. Auf der anderen Seite gibt es für Scheidungsverfahren, die aufgrund von Scheidungsgründen eingeleitet wurden, eine Verjährungsfrist von einem Jahr ab dem rechtskräftigen Scheidungsurteil. Früher gab es diese Regelung nicht. Mit dieser Regelung wollte man Verhindern, dass die Ehepartner nach Jahren, nach dem die Ehe geschieden wurde, mit Klagen auf materiellen und immateriellen Schadensersatzansprüchen (Entschädigungszahlungen) oder auf Unterhaltszahlungen aus Armutsgründen auftauchen[16].
D. Unterhaltszahlung
Parg. 18. Eine weitere Änderung, die durch die neue ZGB gebracht wurde, betrifft die Unterhaltszahlung aufgrund von Armut. Nach der alten Rechtsordnung leistete generell der Ehemann solche Unterhaltszahlungen. Denn das Gesetz enthielt die Regelung „Damit der Ehemann Ansprüche auf Unterhaltsleistungen aufgrund Armut geltend machen kann, ist Wohlstand der Frau erforderlich“ (Art. 144 aZGB). Die neue Rechtsordnung beseitigte die Regelung, um dem Grundsatz der Gleichberechtigung zu entsprechen. (Art. 175). Somit ist der Anspruch eines Ehegatten, sei es des Ehemannes oder der Ehefrau, auf Unterhaltszahlung aufgrund Armutsgefahr gesichert. Das Erfordernis des Wohlstandes fällt weg.
Parg. 19. Für einen Unterhaltszahlungsanspruch setzt Art. 175 ZGB voraus, dass die Schuld der Ehepartei, die Anspruch geltend macht, nicht schwerwiegender als der anderen Partei sein darf. Zum zweiten setzt das Gesetz die Armutsgefahr der Ehepartei voraus. Außerdem sollte die vom Richter festzustellende Höhe der Unterhaltszahlung entsprechend der finanziellen Lage des verpflichteten Ehegatten begrenzt sein. Nach der neuen Regelung, ist das Gericht am Wohnort des Ehegatten zuständig, der Ansprüche auf Unterhaltszahlung geltend macht (Art. 168). Ausserdem entsprechend dem Grundsatz der Gleichberechtigung, haben die Ehegatten den Ehegemeinschaftsausgaben ihrer finanziellen Kräfte entsprechend beizutragen (Art.186/III). Gegenüber dritten Personen besteht für die Ehegatten eine nachgeordnete Verantwortungsstellung (Art. 189)[17].
E. Vermögensverwaltung (Güterstand) in der Ehe
1) Im Allgemeinen
Parg. 20. Die wichtigste Änderung im Familienrecht ist die Regelung bezüglich der Vermögensverwaltung zwischen den Eheleuten[18]. In der Tat galt in der alten Rechtsordnung die Gütertrennung als gesetzliches Vermögensverwaltungsprinzip. Mit dem Entwurf von 1998 wurde das System der „Gütertrennung mit Zugewinnausgleich“ angenommen (Art. 202)[19]. Entgegen diesem Entwurf, also im Entwurf von 1999, (entsprechend dem Schweizerischen Recht, „Anteil am schon verdienten Vermögen“, das 1998 akzeptiert wurde,) wurde die gesetzliche Vermögensverwaltung, welche später in der selben Fassung in den Gesetzestext aufgenommenwurde.
Parg. 21. Die neue Rechtsordnung macht in Vermögensverwaltungssachen (Güterstand) eine Unterscheidung in zwei Arten. Die erste ist die gesetzliche Vermögensverwaltung (Güterstand), die zweite ist die wählbare Vermögensverwaltung.
Parg. 22. Auf der anderen Seite wurde die alte Regelung „Gütergemeinsamkeit“ (aZGB Art. 191-210) aufgehoben.
Parg. 23. Im Gesetz (Art. 206 ff) und in der Literatur ist auch noch vom „außerordentlichen Güterstand“ die Rede[20]. Der Zweck ist ein Wechsel in „Gütertrennung“ (selbstständig oder aufgrund eines Urteils vom Richter) auf Wunsch eines Ehegatten oder aufgrund eines Konkurses (Art. 209) oder einer Pfändung (Art. 210). So entsteht ein außerordentlicher Güterstand. In der Literatur existiert eine Auffassung über die freie Parteienvereinbarung betreffend des Güterstandes[21].
Parg. 24. Nach unserer Auffassung sollte nicht die Rede von der Vereinbarungsfreiheit, sondern vom begrenzten Anzahl und Art die Rede sein.
Parg. 25. In der Tat können die Ehegatten nach der neuen Rechtsordnung zwischen zwei Formen des gesetzlich geregelten Güterstands wählen; zum einen ordentlicher Güterstand und zum zweiten wählbarer Güterstand. Dies war auch früher so. Das bedeutet, dass man nur die Art auswählen kann, die auch im Gesetz geregelt ist. Und im Gesetz existieren in Hinblick auf Güterstand drei Arten. Somit dürfen außerhalb der Grenzen der gesetzlichen Ordnung keine Änderungen vorgenommen werden[22].
Parg. 26. Nach der jetzigen Rechtsordnung können die Ehegatten, die Güterstandsvereinbarung vor oder nach der Eheschließung treffen (Art. 203)[23]. Die Güterstandswahl kann zum Zeitpunkt der Eheschließung der Standesamtsbehörde in schriftlicher Form bekannt gegeben werden. Vereinbarungen, die entweder vor der Eheschließung oder nach der Eheschließung getroffen werden, können im Anwesenheit eines Notars gemacht werden (Artikel nr. 205/I)[24]. Auf der anderen Seite ist die Anzeige einer solchen Vereinbarung nicht erforderlich[25].
2) Güterstände in der neuen Rechtsordnung
a) Anteil an schon verdienten Gütern (verdientem Vermögen – „Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung“)
Parg. 27. In den Artikeln 202 ff. wurden als ordentlicher Güterstand die Beteiligungen an errungenen Gütern akzeptiert. Diese Regelung trat 01. Januar 1988 in Schweiz in Kraft[26], am 1. Januar 2000 in der Türkei.
Parg. 28. Beim „Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung“ hat jeder Partner Güter, die man in zwei Gruppen aufteilen kann. Diese sind entweder errungene Güter oder persönliche Güter (Art. 218). Man kann zu diesen beiden eine weitere Gruppe dazuzählen: „geteilte Güter“. Das bedeutet, dass die Güter, bei denen man nicht nachweisen kann wem die Güter tatsächlich gehören, im gemeinsamen Eigentum stehen. Der Gesetzesgeber räumt das Recht ein, dass Gegenteil unter Beweis zu stellen[27].
Parg. 29. Beim Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung ist die Rede von der Anspruchberechtigung auf die errungen Güter. Das Recht des anspruchsberechtigten Ehepartners ist in der Regel nicht ein gleiches (???) Recht vielmehr ist es ein persönliches Recht (in Artikel 239), vergleichbar mit dem Anspruchsrecht eines Gläubigers.
Parg. 30. Von errungenen Gütern ist die Rede, wenn sie während der Ehe von einem Ehepartner aufgrund seiner erbrachten Gegenleistung erworben werden. Danach sind zwei Voraussetzungen erforderlich, damit man von errungenen Gütern reden kann: die Güter müssen in der Zeit der Gütervereinbarung erworben werden. Außerdem müssen die Güter aufgrund der eigenen erbrachten Leistung erworben worden sein.
Parg.
31.
Für einen Ehepartner sind nach Art. 219 fünf
Beispiele vorgesehen.
Diese sind:
- aufgrund der geleisteten Arbeit [28]
- aufgrund von Zahlungen, wie Sozialversicherung oder Sozialhilfestellen und Organisation,
- oder von Betriebskassen und ähnlichen Kassen geleistet werden,
- Arbeitslosenunterstützung
Parg. 32. Für die persönlichen Güter werden nach Art 220 vier Beispiele aufgezählt.
Parg. 33. Diese sind:
- Güter, die dem eigenen Gebrauch dienen
- Güter, die vor der Eheschließung im Eigentum des Ehepartners standen,
- oder Güter, die man nach der Heirat durch Erbschaft oder Schenkung erhalten hat,
- Schadenersatzsprüche und Vermögenswerte, die an die Stelle der persönlichen Rechte treten.
Parg. 34. Der Gesetzgeber räumt den Ehegatten dass Recht ein, auch die persönlichen Güter zu den errungenen Gütern zu zählen (Art. 221). Nach unserer Auffassung kann diese Regelung zum Nachteil von Frauen, vor allem von Hausfrauen angewendet werden.
b) Gütertrennung
Parg. 35. Diese war der ordentliche Güterstand nach der aZGB. Nach der neuen Regelung ist man der Auffassung, dass es sich dabei nur um wählbaren Güterstand handeln kann. Diese Regelung wird nur in zwei Artikeln (Art. 242-243) behandelt.
Parg. 36. Der Inhalt dieser Regelung besagt, dass die Güter des jeweiligen Ehepartners nur selbst gehören können. Man unterscheidet zwischen Güter, die der Ehefrau angehören und Güter, die dem Ehemann gehören. Eine weitere Unterscheidung gibt es nicht. Dieser Umstand gilt für die Güter, die vor der Eheschließung als auch für die Güter, die man nach der Eheschließung erworben hat[29]. Diese Regelung gewährt jeden Ehepartner, innerhalb der gesetzlichen Normen ausschließliche Rechte, über seinen Güterstand zu verfügen, wie zB Eigentumsrechte, Verwaltungsrechte, Nutzrechte und Verfügungsbefugnisse[30].
c) Gütertrennung mit Zugewinnausgleich
Parg. 37. Gütertrennung und Gütergemeinschaft-Regelung ist eine spezielle Regelung des Türkischen Rechts. Diese Regelungen gibt es nicht in der Schweiz. Solche Regelungen sind im österreichischen Recht zu finden, jedoch sind sie anders als die türkischen Regelungen[31]. Der Zweck dieser Regelung ist es, die Probleme und Schwierigkeiten, die bei der Anwendung des Güterstandes der Errungenschaftsbeteiligung auftauchen können, zu beseitigen[32].
Parg. 38. Aus diesem Grund weist diese Regelung Züge (Eigenschaften?) von beiden Güterständen.
Parg. 39. In der genannten Regelung, haben die Eheleute Eigentumsrechte über ihrem Vermögen; natürlich innerhalb von gesetzlichen Rahmenbedingungen. Weiters haben sie Nutzungsrechte und Veräußerungsrechte[33].
Parg. 40. Die Grundlage für die Gütertrennung mit Zugewinnausgleich bildet eine Dreiteilung der Güter der Ehepartner.
1. Güter, die der Teilung unterliegen
2. Güter, die außerhalb der Teilung sind
3. Güter, die nach dem Gesetz aufgeteilt werden.
Parg. 41. Es sind geteilte Güter, bei denen man nicht mehr nachweisen kann, wem es ausschließlich angehört.
Parg. 42. Beidem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung handelt es sich um Gütern, die der Aufteilung unterliegen, die der Ehegemeinschaft angehören: die gemeinsame Wohnung, Einrichtungsgegenstände, Ferienhaus, Fahrzeuge, etc. und Güter, die dem gemeinsamen Gebrauch bzw. Nutzung dienen.
Parg. 43. Es fallen noch andere Güter unter dieser Kategorie: Wertpapiere, Optionen, Gold, Devisen, Güter, die Mieterträge einbringen. Diese Vermögenswerte dienen der finanziellen Sicherung der Familie in der Zukunft. Weiters kommen noch Güter, die an die Stelle der ersten Aufzählungen treten können: eine 2. Ferienwohnung, 2. Motorboot etc)[34].
d) Gütergemeinschaftsstand
Parg. 44. Bei dieser Regelungsart handelt es sich um einer der wählbaren „Güterständen“ nach der alten als auch nach der neuen Rechtsordnung. Grundlagen dafür bilden die Gemeinschaftsgüter und die persönlichen Güter. Weiters erfolgt bei dieser Regelung eine Unterscheidung zwischen allgemeinem und begrenztem Gütergemeinschaftsstand. Der Gütergemeinschaftsstand beinhaltet Gemeinschaftsgüter und persönliche Güter.
Parg. 45. Güter, die nicht zu den persönlichen Gütern zählen, gelten als Gemeinschaftsgüter. Bei Gemeinschaftsgütern ist meist die Rede vom Gesamthandeigentum (Art. 257/III). Was die Verwaltung betrifft, haben beide Partner nach Art. 262-263 ZGB die gleichen Rechte. Nach dem Gesetz gelten Güter, bei denen man nicht nachweisen kann, dass sie zu den persönlichen Gütern zählen, als Gemeinschaftsgüter (Art. 261 ZGB).
F. Gemeinsame Wohnung
Parg. 46. Eine weitere wichtige Änderung im ZGB betrifft die gemeinsame Wohnung[35]. In der neuen Rechtsordnung sind einige diesbezüglichen Erneuerungen zu finden[36]. Als erste wurde die Regelung im Art. 152/II aZGB „die Wahl bezüglich der Wohnung ist vom Mann zu treffen“ geändert. Nach dem jetzigen ZGB treffen beide Ehegatten die Entscheidung über den Ort der Unterkunft. Auf der anderen Seite ist die Zustimmung der anderen Ehepartner in Wohnungs- bzw. Unterkunftsahngelegenheiten erforderlich (Art. 194). Somit wurde in der neuen Regelung die Definition und Auslegung der gemeinsamen Wohnung spezifiziert.
1. Sicherung der Wohnung durch Mietverträge
Parg. 47. Wenn die gemeinsame Wohnung durch einen Mietvertrag gesichert wird, kann man nicht ohne die Zustimmung des anderen Ehepartners den Mietvertrag kündigen (Art. 194). Gemeinsame Entscheidung/Willensäußerung bezüglich der Unterkunft ist erforderlich. Wenn entgegen dieser Regelung der Mietvertrag gekündigt wird, wirkt dieses Rechtsgeschäft schwebend. Dann ist auch von schwebender Unwirksamkeit die Rede. Demgegenüber kann jedoch der Vermieter in dieser Situation den Mietvertrag kündigen. Wenn der Mietvertrag nur durch einen Ehepartner abgeschlossen wurde, so darf der andere Ehepartner mit einer Willenserklärung gegenüber dem Vermieter als Vertragspartner in den Mietvertrag eintreten (Art. 194/IV). Die Willenserklärung ist nicht formgebunden, wäre aber in schriftlicher Form für eine Beweisführung empfehlenswert. Diese Willenserklärung kommt erst dann zustande, wenn die Erklärung beim Vermieter zugegangen ist.
2. Wenn die gemeinsame Wohnung im Eigentum eines Ehepartners steht
Parg. 48. Der Eigentümer eines gemeinsamen Hauses kann nicht ohne Zustimmung des anderen Ehepartners Rechtsgeschäfte unternehmen, die die Rechte an der Wohnung (Haus) beschränken (zB Hypotheken eintragen lassen ...). Weiters kann der Eigentümer nicht ohne weiteres Rechte an Dritte gewähren (Wohnrecht, Nutzrecht...)[37].
Parg. 49. Durch die neue Regelung hat der andere Ehepartner die Möglichkeit mittels Antrages das Haus im Grundbuch als Familienhaus eintragen zu lassen. Durch diese Eintragung fällt die Gutgläubigkeit bei Dritten weg.
Parg. 50. Nach dem neuen ZGB ist es auch möglich die Befugnisse der Ehepartner in finanziellen Angelegenheiten (verschwenderische Geldausgebung) einzuschränken. Der Zweck einer solchen Regelung ist es, die Ehepartner dazu bringen, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen und Verantwortung übernehmen.
Parg. 51. Das ZGB räumt bei Güterstand der Errungensschaftbeteiligung dem hinterbliebenen Ehepartner einige Rechte, wie z.B. Nießbrauch oder Wohnrecht(Art. 240). Dieser Regelung will dem Umstand Rechnung tragen, dass der Ehepartner den gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten kann. Außerdem darf der hinterbliebene Ehepartner auf dem Vermögen ein Eigentumsrecht oder Nießbrauch geltend machen (Art. 652/I, II). Diese Rechte dürfen unabhängig von der gewählten Güterstand geltend gemacht werden[38]. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Regelung dem hinterbliebenen Ehepartner (der gute aber auch schmerzhafte Erinnerungen hat) die Möglichkeit geben, in dem Familienhaus weiter zu leben.
Parg. 52. Dieses Recht besteht auch dann, wenn der gestorbene Ehepartner zu seiner Lebzeit etwas anderes vorgesehen hat, wie z.B. durch ein Vermächtnis im Testament das Haus an jemand anderen zu hinterlassen. Der hinterbliebene Ehepartner kann bei einem solchem Fall eine Nichtigkeitsklage einbringen. Wenn das Testament für nichtig erklärt wird, kann der überlebende Ehepartner über dieselben Rechte (Wohnrecht, Nutzrecht) verfügen wie vorher[39].
G. Abstammungsrecht
Parg. 53. Eine positive Änderung ist der Wegfall der Unterscheidung zwischen ehelichen und unehelichen (Nachkommen) Kindern[40].
Parg. 54. Eigentlich war diese Sache immer wieder in der Literatur kritisiert worden.
Parg. 55. Um der Kritik Rechnung zu tragen und die Änderungen in Frankreich (1977), Deutschland (1970), und in der Schweiz (1975) zu berücksichtigen, wurde die Unterscheidung aufgehoben (Art. 282)[41]. Nach der neuen Regelung ist es jetzt gleich, ob das Kind ehelich, unehelich oder später legitimiert wurde. Der einzige Unterschied zwischen der alten und der neuen Regelung ist die Vaterschaftsklage.
H. Adoption
Parg. 56. Eine weitere Änderung gibt es bei den Regelungen zur Adoption[42]. Die Kriterien zur Adoption wurden zu einem bedeutenden Ausmaß geändert. Die Voraussetzungen für eine Adoption wurden geändert und viele Ausnahmen wurden eingeführt (Art. 307/II; 310, 311). Das Alter wurde auf 30 gesenkt, früher musste eine Person 35 Jahre alt sein, um ein Kind adoptieren zu können (Art. 306/I, 307/I). Im Gegensatz zur alten Regelung dürfen auch solche Personen eine Adoption durchführen, die selbst leibliche Kinder haben oder haben können[43]. Jetzt dürfen Ehepartner nur gemeinsam adoptieren[44] (Art. 306/I). In der Regel ist es ausgeschlossen, dass nur ein Ehepartner eine Adoption durchführt[45].
Parg. 57. Bei der Adoption sind zwei verschiedene Kriterien von Bedeutung; entweder das Alter der Ehepartner oder die Dauer der Ehe. Im ersten Fall verlangt die Voraussetzung für die Adoption, dass die Eheleute seit mindestens 5 Jahren verheiratet sein müssen. In diesem Fall ist das Alter nicht wichtig, sondern die 5-jährige Ehedauer[46]. In zweiten Fall ist es umgekehrt: wenn jeweils beide Ehepartner das 30 Lebensjahr vollendet haben, können sie gemeinsam adoptieren. In diesem Fall ist die Altergrenze wichtig, nicht die Ehedauer. Jedoch muss immer ein Altersunterschied von 18 Jahren zwischen dem adoptierten Kind und der adoptierenden Person gegeben sein (Art. 308/I). Mit der neuen Regelung wird die Voraussetzung bezüglich des adoptierten Kindes unterschiedlich behandelt. Danach dürfen Ehepartner mit leiblichen Kindern nur Kinder adoptieren, die nicht volljährig sind, unter der Voraussetzung, dass sie vor der Adoption das Kind mindestens ein Jahr lang betreut oder gepflegt haben (Art. 305/I). Demgegenüber dürfen Personen, die beschränkt Geschäftsfähig oder volljährig sind, nicht von Personen mit leiblichen Kindern adoptiert werden (Art. 313/II)[47].
1. Die fürsorgerische Freiheitsentziehung
Parg. 58. Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, ist eine Neuigkeit, die das neue Gesetz hervorgebracht hat. Bei dieser Regelung wurde der Art. 19/III des Grundgesetzes als Grundlage zur Gesetzgebung herangezogen. Ferner wurde auch der Art. 397a-397ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuch zur Hilfe genommen[48].
Parg. 59. Nach dieser Regelung kann man einer Person die Freiheit aus Schutzgründen (Schutzwürdigkeit) entziehen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, die Person kann zu eigenem Schutz einer Erziehungsanstalt überlassen werden. Im Gesetz sind folgende Personen aufgezählt worden; Geisteskranke, Drogen- oder Alkoholsüchtige, Gefahr hervorrufende Kranken, Straßenstreiber etc[49].
2. Unsere Auffassung über die erforderlichen Änderungen im Familienrecht
Parg. 60. 1) Familienrecht beruht auf gegenseitiger Liebe und gegenseitigem Respekt. Die Familie ist die einzige Institution, wo die Rechtsordnung am wenigsten eingreifen kann. Denn in der Familie haben andere Regeln, wie zB Bräuche, Sitten, Gewohnheiten, Manieren, Religiöse Gebote/Verbote, mehr Bedeutung.
Parg. 61. Das Gesetz verstößt gegen diese erwähnten Grundsätze im folgenden Punkte:
a. Einem Ehepartner, der ohne Gegenleistung sich für die Familie aufopfert (meistens die Frau) sollte im Falle einer Beendigung der Ehe in irgendeiner Form eine Entschädigung für ihre erbrachten Leistungen erhalten. Eine solche Methode kommt dann nur zur Anwendung, wenn ein mit der Familie zusammenlebendes volljähriges Kind Erbe wird[50].
b. Außerdem sollte der in a) erwähnte Ehepartner sozial versichert werden, und die Beiträge sollten aus Haushaltsbudget bezahlt werden. Solch eine Regelung sollte durch die Sozialversicherungsgesetze geregelt werden.
c. Im Falle der Beendigung einer Ehe sollte die gemeinsame Wohnung und die darin befindlichen Gegenstände der Frau überlassen werden. Das SZGB enthalt bereist Regelung in dieser Richtung. Lauf Art. 169 SZGB „ darf ein Ehepartner ohne Zustimmung des anderen Partners, die gemeinsame Wohnung nicht kündigen, nicht übertragen oder Rechte über die Wohnung nicht durch Rechtsgeschäft beschränken…“ Schlussendlich (?) findet sich eine solche positive Regelung im Gesetz (Art. 652).
d.
Wenn unter den Eheleuten Gütertrennung mit Zugewinnausgleich vereinbart wurde
sollte die Vermögenswerte im Falle einer Beendigung der Ehe gleichmäßig unter
den Ehepartnern aufgeteilt werden, wie zB gemeinsame Wohnung,
Einrichtungsgegenstände, gemeinsames Auto, gemeinsames Ferienhaus. Die durch zB
eine Erbschaft erworbenen Güter eines Ehepartners sollten ausgeschlossen werden[51].
Eigentlich gibt es dafür eine Regelung im Gesetz. Güter, die auf solchem Wege
erworben werden und andere die nur einem Ehepartner allein gehören sollten
nicht der gleichmäßigen Aufteilung unterliegen.
Jedoch sollten die Güter und Gewinne aus solchem Vermögen in die gemeinsame
Nutzung eingebracht werden, dann kommt eine Aufteilung in Frage[52].
Wenn eine natürliche Aufteilung nicht möglich ist, dann sollten die Güter bei
einem Ehepartner bleiben. Der andere Ehepartner sollte für seinen Anteil
entschädigt werden (zivilrechtlicher Teilung)
e. Wenn zwischen den Eheleuten die Gütertrennung mit Zugewinnausgleich als gesetzlicher Güterstand vereinbart worden ist, dann sollte nur die Frau Anspruch auf Angleichungsbeitrag im Falle eines Todes haben[53]. Bei einer Scheidung sollte wieder der Ehefrau eine Entschädigung unter Berücksichtigung der finanziellen Lage des Mannes zugesprochen werden. Dabei sollte als Vorraussetzung eine mindestens 3 -jährige Ehezeiten bestanden haben.
f. Bei einer Scheidung sollte die Ehefrau auch eine Entschädigung bekommen. Diese sollte sich nach der finanziellen Lage des Ehemannes, Dauer der Ehe, Beitrag der Frau zur Vermögensbildung der Ehe richten.
Parg. 62. 2) Dabei muss auch hingewiesen werden, dass es empfehlenswert wäre, die Errungenschaftsbeteiligung nicht als gesetzlichen sondern als vertraglichen Güterstand anzuerkennen.
Parg. 63. 3) Für den Ehepartner, der seine Zeit den Kindern widmet und dabei eine aktive Rolle übernimmt, sollte ein Betrag zur freien überlassen werden. Eine solche Regelung enthält Art. 162 des SZGB. Wortlaut des Art. 162 des SZGB; “Der Ehepartner, der sich der Aufziehung der Kinder und der Hausarbeit hingibt oder dem anderen Ehepartner bei dessen Arbeit und Beruf unterstützt hat das Recht vom Ehepartner einen Betrag zur freien Verfügung anzufordern…“[54].. mit dieser Regelung wird eine Existenzminimum für die Frauen gewährleistet[55]. Außerdem sollte auch eine Entschädigungsanspruch für den Ehepartner zur Verfügung stehen, der im Betreib des anderen mehr mitgewirkt hat als für die Versorgung der Familie tatsächlich erforderlich wäre. Eine solche Regelung fehlt leider im türkischen ZGB, obwohl es das SZGB eine solche Regelung enthält.
Parg. 64. Außer den oben genannten Regelungen gibt es noch die Regelung, die unter der Überschrift „Trennungsfolgen“ in ZGB Art. 118 geregelt ist: „Mit der Trennung tritt vom Gesetzes wegen Gütertrennung ein“. Wie man erkennt kann das Gesetz mit der jetzigen Fassung nicht den Ansprüchen der Zeit und den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen, obwohl behauptet wird, dass man die Änderungen in Schweiz berücksichtigt hätte[56].
Parg.
65.
4) Das neue Gesetz
hat der Ehefrau eine auf dem Papier bleibende Gleichberechtigung gewährt. Man
kann sagen, dass sie gegenüber dem Mann Schutzlos dasteht.
Außerdem beinhaltet das Gesetz nicht die neuen rechtlichen Institutionen, die
für die technologischen Entwicklungen und für die wirtschaftlichen Erfordernisse
notwendig sind. Nach einer Meinung in der Literatur ist dieser Mangel als ein
fataler Fehler zu bezeichnen[57].
Parg. 66. 5) Wie man aus den Erläuterungen erkennen kann, ist das Familienrecht ein wichtiges Gebiet. Dieses Gebiet umfasst den ganzen Lebensbereich einer Person von Geburt an bis zum Tode, seinen Glück und sein Wohlergehen. Familienrecht interessiert die ganze Gesellschaft. Obwohl dieses Gebiet sehr wichtig ist, konnten die Gesetzgeber nicht die erforderliche Sorgfalt zeigen[58]. Man muss noch anmerken, dass es schon eine ganz neue vorbildliche Arbeit zu diesem Thema gibt.
Fazit
Parg. 67. Mit der neuen ZGB wurden viele wichtige Änderungen im Familienrecht eingeführt. Nach einer allgemeinen Untersuchung, kommt man zu der Ansicht, dass der Zweck der Änderungen eine Verbesserung der Stellung der Frau war. Die wichtigste Regelung dabei ist der Güterstand. Jedoch widersprechen Regeln in dieser Hinsicht dem eigentlichen Zweck; dem Schutze der Frau.
Parg. 68. Die Betreffenden Regelungen sind vor allem zum Nachteil der nicht erwerbstätigen Frauen. Bei der Vorbereitung des neuen Gesetzes hätte man einige Schutzvorkehrungen für die Frau, die sich um die Kinder kümmert und die ihren Ehemann bei seiner Arbeit oder ihn am Arbeitsplatz (z. B. Arztpraxis, Anwaltskanzlei...) unterstützt, treffen können.
Parg. 69. Dabei hätte man das Schweizerische ZGB als Beispiel heranziehen können. Leider wurde von der beauftragten Kommission diesen Sachen keine Beachtung geschenkt.
Parg. 70. Solange diese erforderlichen Regelungen nicht getroffen werden, wird es nicht möglich sein, die Frauen, insbesondere Hausfrauen bzw. die Frauen, die nicht erwerbstätig sind, zu schützen.
Parg. 71. Außerdem sollten die Richtlinien der EU bei der Vorbereitung der relevanten Änderungen und Neuerungen beachtet werden.
Parg. 72. Wenn man so verfährt, dann kann auch eine Anpassung der Türkischen Regelungen an die Europäischen in kurzer Zeit möglich sein.